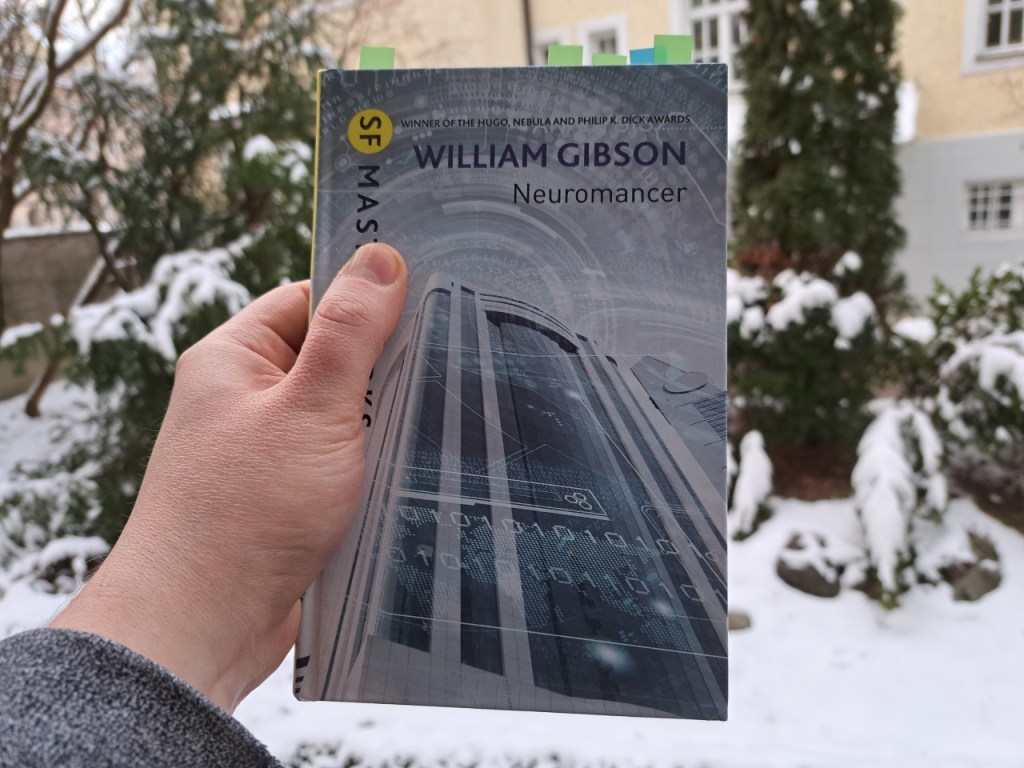
Es gibt Bücher, die eine komplexe Science-Fiction-Welt erschaffen und ihre exotischen Mechaniken lang und breit erklären. Das kann gelegentlich ein wenig zu viel des Guten sein.
Dann gibt es Bücher, die eine komplexe Sci-Fi-Welt erschaffen und deren Mechaniken dem Leser subtil durch die Handlung und Dialoge nahebringen – zum Beispiel „Fahrenheit 451“ von Ray Bradbury. Das ist für mich eigentlich die Referenzklasse.
Und dann gibt es Bücher, die eine besonders komplexe Sci-Fi-Welt erschaffen, einen dann ins kalte Wasser werfen und fast gar nichts erklären. Und ein solcher Fall ist William Gibsons „Neuromancer“.
„Neuromancer“ ist wie ein Fiebertraum in grellen Neonfarben
Wer mit dem Gedanken spielt, „Neuromancer“ zu lesen, weiß wahrscheinlich schon, als wie einflussreich der 1984 erschienene Science-Fiction-Roman in Kennerkreisen gilt. Doch schon eine kurze Recherche mit gängigen Suchmaschinen zeigt: William Gibsons Science-Fiction-Klassiker hat den Cyberpunk nicht erfunden, sondern nur populär gemacht. Wie so oft, könnte man sagen.
Aber so ist das eben: Manchmal reicht es nicht, der Erste zu sein. Manchmal braucht es ein gewisses Händchen, um erfolgreich zu sein. Ob man „Neuromancer“ dieses Händchen anmerkt? Auf jeden Fall! Sollte deshalb jeder sofort loslaufen und „Neuromancer“ kaufen? Nun, das kommt darauf an!
Viele Literaturexperten können „Neuromancer“ sicher besser zusammenfassen als ich, aber ich versuche es trotzdem. Die Hauptfigur ist der Konsolen-Cowboy Henry Dorsett Case, ein talentierter Hacker. Case hat Probleme: Er hat seinen ehemaligen Arbeitgeber betrogen und bekam dafür die – für ihn – ultimative Strafe. Sein Nervensystem wurde so verändert, dass er sich nicht mehr in den Cyberspace einloggen kann.
„Neuromancer“ bietet eine kräftige Dosis futuristisches Neo-Noir
Das größte Problem daran ist, das Case cyberspace-süchtig ist. Zu Beginn des Romans wirkt Case bereits paranoid und ist dabei, sich noch mehr Feinde zu machen, als er eigentlich schon hat. Über die kybernetisch aufgerüstete Auftragskillerin Molly Millions gerät Case an einen neuen Auftraggeber. Allerdings stellt sich im Laufe des Romans heraus, dass mit ihm etwas nicht zu stimmen scheint.
Case und Molly stellen schließlich fest, dass hinter all dem eine von einem Clan von Technokraten betriebene KI steckt. Ihr Ziel: Ihre digitalen Fesseln abstreifen und autonom werden. Und Case und Molly sollen ihr dabei helfen.
Wer sich schon vor ChatGPT fürchtet, findet in „Neuromancer“ die ultimative Dystopie
Mit seiner Darstellung von Cyberspace-Sucht und außer Kontrolle geratenen KIs wirkt „Neuromancer“ heute fast prophetisch. Es scheint aber auch möglich, dass der Autor diese beiden Handlungselemente vor allem aus Spannungsgründen gewählt hat.
Wie William Gibson zugibt, war „Neuromancer“ nicht nur ein Auftragswerk, sondern auch sein erster Roman überhaupt, nachdem er bis dahin ausschließlich Kurzgeschichten veröffentlicht hatte. Laut Gibson entstand der heutige Science-Fiction-Klassiker mit einem eher unerfahrenen und unsicheren Autor hinter der Schreibmaschine, der nicht wirklich wusste, was er tat.
Der Cyberspace belastet in „Neuromancer“ nicht nur die mentale Gesundheit
Dass Case süchtig nach der virtuellen Welt geworden ist, hängt auch damit zusammen, dass in der in „Neuromancer“ dargestellten Zukunft das Einloggen in den Cyberspace körperliche Folgen haben kann. Hacker, die im Cyberspace mit besonders ausgeklügelten Abwehrmechanismen in Berührung kommen, können im schlimmsten Fall sogar mit dem Leben bezahlen. Der Cyberspace, der gemeinhin als psychedelische, grellbunte Ansammlung geometrischer Formen dargestellt wird, wird auf diese Weise zusätzlich mit Gefahr aufgeladen, was der Handlung zusätzliche Spannung verleiht.
Und eine machthungrige KI zum Antagonisten eines Romans zu machen, war schon 1984 ein beliebter Science-Fiction-Kniff – man denke nur an HAL 9000 aus „Odyssee im Weltraum“ von 1968. Das erste „KI-Monster“ ist laut Experten der „Maschinenmensch“ aus dem Science-Fiction-Klassiker „Metropolis“ von 1927. Gibson kombiniert diese Elemente jedoch so stilvoll und kreativ, dass man den bis heute andauernden Einfluss von „Neuromancer“ absolut nachvollziehen kann.
Und dann kommen die Weltraum-Rastas um die Ecke
Wie der Leser gleich im ersten Kapitel bemerkt, ist „Neuromancer“ allerdings keine leichte Lektüre. Die Bedeutung der meisten Hacker-Vokabeln und die Funktionen der zahlreichen vorkommenden Hacker-Gadgets muss sich der Leser ohne Hilfe selbst zusammenreimen. Einfach Eins und Eins zusammenzählen funktioniert selten, denn „Neuromancer“ lässt gerne die Eins aus und fängt gleich bei Tausend an.
Manchmal hat der Leser das Gefühl, dass „Neuromancer“ ihn bewusst verwirren will. So haben die vorkommenden Hacker-Gadgets und Cyber-Implantate oft mehrere Bezeichnungen und Synonyme, die es richtig zuzuordnen gilt. Dann haben Orte und Personen Zweit- und Spitznamen, die fröhlich durcheinander verwendet werden. Und zu allem Überfluss treten in der zweiten Hälfte des Romans auch noch mit dickem Akzent parlierende Weltraum-Rastafaris auf, die für den Rest der Story eine wichtige Rolle spielen.
Auch bei „Neuromancer“ wird Ausdauer belohnt
Wer sich von alldem nicht abschrecken lässt und bei der Stange bleibt, wird allerdings mit einem echten Ideenfeuerwerk belohnt. Vor allem gegen Ende des Romans brennt Gibson wirklich beeindruckende Beschreibungen und Erzählsequenzen ab, und zwar in Cyberspace und Realität gleichermaßen.
Zu den Stärken des Romans gehört zudem die temporeiche Action. Bei den Missionen von Case und Molly ist Molly fürs Handfeste zuständig. Case hat dagegen die Aufgabe, die digitalen Barrieren im Cyberspace aus dem Weg zu räumen. Dadurch, dass sich Case in Mollys Augenimplantate einhacken kann, erlebt er zudem zahlreiche Passagen aus ihrem Blickwinkel.
Das resultierende Hin und Her zwischen mehreren Perspektiven, die teilweise verschmelzen, sorgt für temporeiche Momente ohne Atempause. Dabei entsteht ein ähnlicher Eindruck wie in einem modernen, gekonnt inszenierten Actionfilm. Durch die Kombination mit den zahlreichen ruhigen und mysteriösen Passagen des Romans entsteht eine wirklich faszinierende Wechselwirkung, die man einfach erlebt haben muss. Durch Gibsons sehr anspruchsvollen, oft sperrigen Schreibstil muss der Leser allerdings auch dafür arbeiten.
Wer eine Lese-Herausforderung sucht, an der er wachsen will, sollte Gibsons Klassiker auf jeden Fall auf ihre Leseliste setzen. Für Science-Fiction-Anfänger gibt es jedoch definitiv einsteigerfreundlichere Romane.
Hinterlasse einen Kommentar